»Cause I no dey shame
Djinee – I No Dey Shame (2009)
I no dey shame for you
For you anything I go do
No matter anything wetin you don go through
Cause I no dey shame
I no dey shame for you
I fit go anywhere with you
Cause baby
I dey in love with you
Oh oh (oh oh)«
Als Schwuler in Nigeria zu leben, kann lebensgefährlich sein. Wie in den meisten afrikanischen Ländern ist Homosexualität in Nigeria illegal, homosexuelle Kontakte werden mit 14 Jahren Gefängnis bestraft. Selbst die Betreiber von Clubs oder Bars, in denen schwule Kontakte geduldet werden, können dafür hinter Gitter kommen. Besonders düster sieht es in einigen nördlichen Bundesstaaten aus, die muslimisch geprägt sind und in denen die Scharia angewendet wird. Danach können Männer, die der »Sodomie« bezichtigt werden, zu Tode gesteinigt werden. Nochmals verschärft hat sich die Lage im gesamten Land, als 2014 der »Same Sex Marriage (Prohibition) Act« in Kraft trat. Danach ist selbst die öffentliche Beschäftigung mit Homosexualität verboten. Würde ich gerade in Nigeria sein, dürfte ich diesen Beitrag nicht veröffentlichen.
Das menschenverachtende Gesetz findet in weiten Teilen der nigerianischen Bevölkerung – der Norden ist, wie erwähnt, muslimisch, der Süden christlich – großen Zuspruch. Homosexualität ist eine »Sünde« – da sind sich Muslime und Christen einig. Für schwule Männer bleiben so oft nur zwei Möglichkeiten: Das Exil in einem anderen Land, sofern sie sich das leisten können, oder ein Leben im Verborgenen. Trotz der extrem gefährlichen Situation gab und gibt es Menschensrechtsaktivisten, die sich für Aufklärung und eine Verbesserung der Lebenssituation von LGBTQ-Menschen einsetzen. Von ihnen erzählt der nigerianische Autor Nnanna Ikpo in seinem Debütroman »Fimí Sílẹ̀ Forever«, der 2017 erschien ist und in diesem Jahr für die Lammys nominiert war.
Zwischen Privatleben und Rampenlicht
Oluwole und Olawale – kurz Wole und Wale – sind Zwillingsbrüder und kämpfen mit ihrer Organisation »Afrospark« für Menschenrechte. Beide sind Anwälte: Wole praktiziert in einer Kanzlei, Wale, aus dessen Sicht der Roman erzählt wird, ist als Rechtsdozent an einer Universität tätig. Nach ihrer Geburt zunächst getrennt, trafen sie als Jugendliche in einem Internat wieder aufeinander und beide fühlen, dass sie anders sind. Während sich Wale als bisexuell sieht, ist Wole homosexuell. Beide verbergen ihre sexuelle Identität allerdings. Ins Licht der Öffentlichkeit rücken sie das erste Mal, als sie den jugendlichen Tani Cross vor Gericht verteidigen. Tani Cross soll einen anderen Jungen in einem Internat zu Sex verführt haben und wurde daraufhin von Mitschülern verprügelt. In einem Gerichtsverfahren, das die nigerianische Gesellschaft aufmerksam verfolgt, erreichen sie einen Freispruch für Tani und eine Entschädigung durch die Schule, die ihre Aufsichtspflicht gegenüber den gemobbten Jungen verletzt hat. Wole und Wale stehen das erste Mal im Rampenlicht. Das führt dazu, dass sie Anfeindungen ausgesetzt sind und in der Öffentlichkeit von Sicherheitskräften geschützt werden müssen.
Ihr berufliches und öffentliches Engagement verwebt Nnanna Ikpo mit ihrer Familiengeschichte. Ihr Vater saß im Gefängnis, weil er Sex mit einem Mann hatte. Erst als Jugendliche treffen Wale und Wole das erste Mal auf ihn und erfahren nach und nach, warum ihr Vater im Gefängnis saß. Ihre Mutter – stolz auf ihre beiden Söhne, die erfolgreich ihr Jurastudium absolviert haben – unterstützt sie in ihren Aktivitäten als Menschenrechtler und schlägt ihnen vor, gemeinsam mit einer Hilfsorganisation einen Film über die Situation von Homosexuellen in Nigeria zu drehen. Beide willigen ein und planen die Premiere des Films an der Universität, an der Wale als Dozent arbeitet.
Natürlich trifft Wale hier auf Ablehnung, insbesondere von einer Professorin, aber er findet auch Unterstützer. Kurz nach der Premiere planen sie zudem, ihre jeweilige Verlobte zu heiraten. Denn die Gerüchte, dass Wole und Wale auch homo- bzw. bisexuell sind, sollen für immer verstummen. Während die Filmpremiere erfolgreich über die Bühne geht, steht die geplante Doppelhochzeit unter keinem guten Stern. Während die Brüder auf dem Weg zur Trauung sind, schickt ein Unbekannter an die Bräute und deren Familien Fotos von Wole und Wale, die beide in eindeutigen Situationen mit Männern zeigen. Damit nicht genug, taucht die nigerianische Polizei bei einer Party am Vorabend der Hochzeit auf, um die Anwesenden wegen »Sodomie« oder deren Unterstützung zu verhaften. Am Ende der Razzia gibt es Tote.
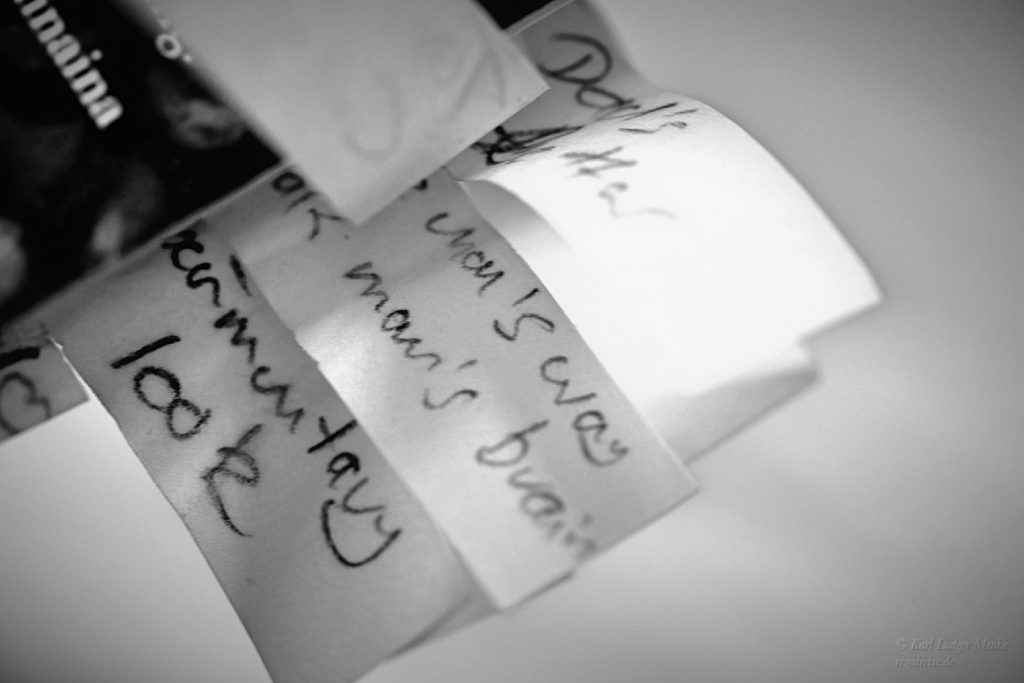
Nigeria ist noch nicht so weit
Nnanna Ikpos Roman gewährt einen lebensnahen und detaillierten Einblick in das Leben schwuler Männer in Nigeria. So berichtet Wale zum Beispiel in einer Rückblende über die Bildung des »Rainbow Talks«, einer Art Selbsthilfegruppe von schwulen Männern, entstanden aus einer Sex-Hotline. Heimlich treffen sich die Teilnehmer, alle mit einem Decknamen getarnt, an verborgenen Orten – zum Austausch, zur Bildung von Netzwerken oder für Sex. Dabei wechselt Ikpos Erzählung zwischen dokumentarischen Berichten, inneren Monologen, Briefen und E-Mail-Wechsel sowie eingestreuten Gedichten. Das lässt die Lektüre an manchen Stellen sperrig werden, denn die Sprünge sind nicht immer stringent und die Dramaturgie des Romans kommt ins Schwanken.
Dafür ist sein Ich-Erzähler Wale ein glaubwürdiger und sympathischer Charakter, der stellvertretend für die Zerrissenheit vieler schwuler Nigerianer steht. Einerseits der Wunsch, weiter in Nigeria zu leben und für ein liberaleres, offeneres Land zu kämpfen, andererseits das persönliche Schicksal, das sie dazu verdammt, ihre Liebe zu Männern im Verborgenen zu leben. Dazu gehört auch der Zwang, dem nicht wenige Männer nachkommen, zum Schein eine Frau zu heiraten. In einer der stärksten Szenen des Romans berichtet Wale von einer Aufführung, bei der Studentinnen und Studenten seiner Uni kurze Texte von Schwulen und Lesben vortragen. Authentische Texte, die mal Anklage, mal Beichte, mal Trauerrede sind. Zum Schutz tragen alle eine Maske – denn Nigeria ist noch nicht so weit, die Gesichter von schwulen oder lesbischen Menschen zu sehen.
Der Roman »Fimí Sílẹ̀ Forever«, was übersetzt soviel wie »Verlasse mich für immer« oder »Lass mich allein, für immer« bedeutet, gibt schwulen Männern aus Nigeria eine Stimme. Ein wichtige Stimme, auch wenn sie gelegentlich ungewohnt oder langatmig wirkt. An einer Stelle des Romans lässt Ikpo seinen Wale ausführlich mit den Studentinnen und Studenten über Menschenrechte diskutieren. Eine Diskussion, so wichtig sie im realen Leben ist, in der Fiktion etwas schleppend und belehrend wirkt. Der dokumentarische Charakter wird hier überdehnt. Demgegenüber steht allerdings eine menschliche, nachvollziehbare und eindringliche Lebensgeschichte eines jungen Mannes, der am Ende gespalten bleibt. Sein Schicksal verdeutlicht eindringlich, wie aussichtslos die Situation erscheint. Denn gerade die Menschen, die für eine Veränderung streiten wollen, müssen entweder schweigen, lügen oder flüchten.
Bibliographische Angaben
Gelesen habe ich folgende Ausgabe:
Nnanna Ikpo: Fimí Sílẹ̀ Forever : Heaven Gave it to me. – London : Team Angelica Publishing, 2017
ISBN: 978-0-9955162-0-5
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags ist mir leider keine deutsche Übersetzung bekannt.
Weiterführende Links
- Letters to My Africa – Blog von Nnanna Ikop
- Nnanna Ikop bei Twitter
- HRDA Chronicles: David Nnanna Ikpo im Portrait (YouTube)
- »Fimí Sílẹ̀ Forever : Heaven Gave it to me« ist für die diesjährigen Lammys nominiert
Soundtrack zum Buch
Der oben zitierte Song »I no day shame« stammt von dem nigerianischen Sänger Djinee, der in seinem Heimatland einer der erfolgreichsten Musiker ist. Nnanna Ikpo erwähnt den Song in seinem Roman.
Thank you. I appreciate