Melanie Walz hat den Klassiker »David Copperfield« von Charles Dickens neu übersetzt. Eine Rarität in einem immer schneller werdenden Buchmarkt. Ob sich die Lektüre lohnt?
Wer liest und kauft noch Klassiker? Schaut man auf die aktuellen Veröffentlichungen der deutschsprachigen Verlage, so finden sich wenige neuere Ausgaben von Büchern, die vor dem 20. Jahrhundert geschrieben wurden. Ausnahmen bieten gelegentlich Verlage wie Hanser, Manesse oder Reclam sowie einige kleinere, unabhängige Verlage, die Tradition und Texte pflegen. In den Ramschkisten der Buchläden und modernen Antiquariaten finden sich dafür billig gemachte Nachdrucke von gemeinfreien Werken, deren Texteditionen oft fragwürdig sind – gerade auch bei Übersetzungen. Während meiner jungen Leserjahre boten Artemis & Winkler, C.H. Beck, dtv, der Deutsche Klassiker Verlag, Diogenes, Insel, Manesse, Reclam, Suhrkamp und einige mehr Klassikerausgaben in unterschiedlicher Ausstattung – vom Taschenbuch bis hin zum Prachtband mit Ledereinband – wohlfeil. Beim heutigen Blick in die Auslagen der Buchhandlungen brennen einem die kitschig gestalteten Cover von Young Adult, Dark Romance und Urban Fantasy in den Augen, bis es tränt. Klassiker? Was soll das sein?
Erfreulich also, wenn ein großer Verlag wie Rowohlt sich daran macht, eine Neuübersetzung des Klassikers »David Copperfield« von Charles Dickens zu veröffentlichen. Wie fast alle Dickens-Romane erschien »David Copperfield« zunächst in monatlichen Fortsetzungen zwischen Mai 1849 und November 1850. Ende 1850 erfolgte dann die erste Buchausgabe des Romans. Die aktuelle Neuübersetzung stammt von der renommierten Übersetzerin Melanie Walz, die 2011 bereits Dickens Roman »Great Expectations« unter dem Titel »Große Erwartungen« ins Deutsche übertragen hat. Beste Voraussetzungen also für die Wieder- oder Neuentdeckungen des klassischen Bildungsromans, der zudem als der Roman gilt, in dem Dickens seine eigene Biographie am stärksten in die Handlung hat einfließen lassen.
Auf den gut 1250 Seiten der deutschen Ausgabe zeichnet Dickens den Lebensweg seines Helden David Copperfield nach, der als Ich-Erzähler Rückschau hält. Geboren an einem Freitag mit einer Glückshaube, also Teilen der Fruchtblase, die sich um den Kopf des Kindes legen, sagten Hebamme und Nachbarsfrauen dem Jungen ein unglückliches Leben voraus, sowie die Fähigkeit, Gespenster und Geister zu sehen. Das mit dem Unglück sollte für David schon früh in Erfüllung gehen, denn schon vor seiner Geburt ist sein Vater gestorben. Seine Mutter Clara kümmert sich mit Hilfe ihres Dienstmädchens Peggotty um den Jungen, während seine einflussreiche Tante, Miss Betsy Trotwood Copperfield, nach der Geburt wutentbrannt das Haus verlässt – hatte sie doch auf ein Mädchen gehofft. Einige Jahre später wird sie sich als die wahre Fee herausstellen, die David nach seinen ersten unglücklichen Erfahrungen mehr als wohl gesonnen ist.
Eine gute Fee und ein vielfältiges Figuren-Ensemble
Sein Lebensweg führt ihn weg von einer liebevollen Mutter und einem jähzornigen Stiefvater über eine miserabel geführte Schule und einer Hilfstätigkeit in einer Weinhandlung sowie einer Ausbildung bei einem Rechtsanwalt bis zu einer Tätigkeit als Parlamentsreporter. Schließlich wird David Copperfield ein erfolgreicher und anerkannter Schriftsteller, ähnlich wie sein Erfinder Charles Dickens. Lesenswert wird der Roman nicht so sehr durch die Entwicklungsgeschichte, sondern durch die zahlreichen Figuren, die den Lebensweg von David Copperfield kreuzen. Es gibt die bösen Charaktere, wie das Geschwisterpaar Mr. und Miss Murdstone, die das Leben von David und seiner Mutter zur Hölle machen, den skrupellosen Betrüger Uriah Heep, dem David in der Anwaltskanzlei von Mr. Wickfield begegnet oder den zwielichtigen Steerforth, dessen Freundschaft zu David sich als Verhängnis entpuppt und dessen Unstetigkeit andere mit ins Unglück reißt.
Es gibt die tragischen Begleiter, wie etwa Mr. Micawber, ein herzensguter Familienvater, der von einer finanziellen Notlage in die nächste taumelt. Daniel »Dan« Peggotty, Bruder seiner Kinderfrau Peggotty, bei dem David dessen Nichte Emily kennenlernt – seine erste Liebe aus Kindertagen. Beide Männer werden bis zum Schluss eine wichtige Rolle im Leben von David Copperfield spielen. Nicht zuletzt sind da auch noch zwei Frauen, in die sich David verliebt. Zunächst Dora Spenlow, eine kindlich-naive Frau, deren Vater die Kanzlei besitzt, in der David arbeitet. Als die geheime Liaison zwischen ihr und David auffliegt, unterbindet ihr Vater diese Beziehung – um kurz danach zu sterben. Entgegen aller Widerstände können Dora und David dennoch heiraten, eine Ehe, die durch den frühen Tod von Dora ein jähes und trauriges Ende findet. Nach dem Verlust von Dora besinnt sich David auf eine andere, eine frühe Kinderliebe: die zu Agnes. Sie ist die Tochter von Dr. Strong, in dessen Schule David unterrichtet wurde. Über all die Jahre besteht zwischen Agnes und eine David ein Verhältnis, das beide als eine Geschwister-Beziehung ansehen. Ihre Vertrautheit begleitet sie durch Höhen und Tiefen, bis beide sich ihre Liebe zueinander eingestehen.
Als gute Fee in diesem bunten Figuren-Ensemble fungiert die bereits erwähnte Tante Betsy, die sich nach der Geburt von David von ihm und seiner Mutter abwendet. Als David sich nach dem Tod seiner Mutter an sie wendet, adoptiert sie ihn und unterstützt ihn soweit sie kann. Dickens zeichnet all diese und viele weitere Figuren differenziert, immer wieder auch mit einem leichten Hang zur Zuspitzung oder zur Karikatur. Das dürfte für die Übersetzerin Melanie Walz eine Herausforderung gewesen sein. Nicht selten wurden in früheren Übersetzungen die Figuren derart überzeichnet, dass ihr eigentlicher Charakter eher einer Karikatur denn einem Charakter entsprach. Hier bedient sich Melanie Walz einer schnörkellosen, nüchternen Sprache, was der Lektüre zugute kommt. In ihren Worten tritt die Differenziertheit, die Schärfe, die Klarheit des Originals deutlicher hervor, als in einigen anderen Übertragungen. Das ist wirklich sehr gelungen! Oft werden neue Übersetzungen mit dem Anspruch nach „Modernisierung“ gerechtfertigt. Ich denke hier steht das nicht so sehr im Vordergrund, sondern eine deutlich klarere Übertragung dessen, was Dickens vor über 150 Jahren geschrieben hat.
Wieviel Charles verkörpert der David?
Literaturwissenschaftler und Kritiker heben bei »David Copperfield« immer wieder auch auf die biographischen Bezüge ab, die Melanie Walz in ihren Kommentaren am Ende des Buches ausführlich beleuchtet. Zum Entstehungszeitpunkt des Romans hat Dickens an einer Autobiographie gearbeitet, die er später vernichtet hat. Dass es Parallelen und Ähnlichkeiten im Roman zu Dickens eigenem Leben gibt, dürfte wohl unbestreitbar sein. So dürfte für den finanziell angeschlagenen Mr. Micawber Dickens eigener Vater Model gestanden haben, denn als Dickens 12 Jahre alt war, musste sein Vater ins Schuldgefängnis Marshalsea und er selbst als Arbeitssklave in einer Fabrik für Schuhcreme schuften. Auch in der beruflichen Entwicklung von David gibt es Parallelen zu Charles: Das Erlernen der Stenographie, die Arbeit als Parlamentsberichterstatter und schließlich als erfolgreicher Schriftsteller.
Im Zeitalter der Autofiktion wirkt Dickens Text modern, denn er gestaltet für sich ein Alter Ego, dem er – je nach Bedarf – autobiographische Ereignisse oder Charakterzüge geben kann, ohne sich selbst in den Fokus zu setzen. Es waren, so beschreibt es Melanie Walz, gerade sehr schmerzhafte Erlebnisse, die Dickens in der Figur des David noch einmal durchlebt und uns als Leser teilhaben lässt. Auch das unterstreicht die Bedeutung des Romans im Gesamtwerk. Dickens selbst soll den Roman seinen „liebsten“ genannt haben.
Die – erneute – Lektüre des Klassikers »David Copperfield« sei also hiermit sehr empfohlen – besonders in der Übersetzung durch Melanie Walz. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings bei der Neuausgabe schon. Als klassischer „Von-vorne-nach-hinten-Leser“ habe ich leider erst etwa zur Mitte des Buches bemerkt, dass es hinten auch noch Anmerkungen zu einzelnen Textstellen gibt. Hätte ich nicht geblättert, wäre mir das wohl erst nach Beendigung der Lektüre aufgefallen, was bedauerlich ist. Weshalb der Verlag hier nicht einfach mit Fußnoten gearbeitet hat, ist mir ein Rätsel. Dennoch eine freundliche Leseempfehlung für einen Roman, der sowohl Young Adult, Dark Romance und auch Urban Fantasy umfasst – nur eben stilistisch und erzählerisch viel, viel besser!
Bibliographische Angaben:
Gelesen habe ich folgende Ausgabe:
Charles Dickens: David Copperfield. – Aus dem Englischen übersetzt und herausgegeben von Melanie Walz. – Hamburg : Rowohlt, 2024. – 1294 S. – 45,- Euro
ISBN 978-3-498-00297-8
Zum Abgleich mit dem englischen Original habe ich folgende Ausgabe zu Rate gezogen:
Charles Dickens: David Copperfield. – With an Introduction and Notes by Jeremy Tambling. – Revised Edition. – London : Penguin, 2004. – 974 S. UK: 7,99 £
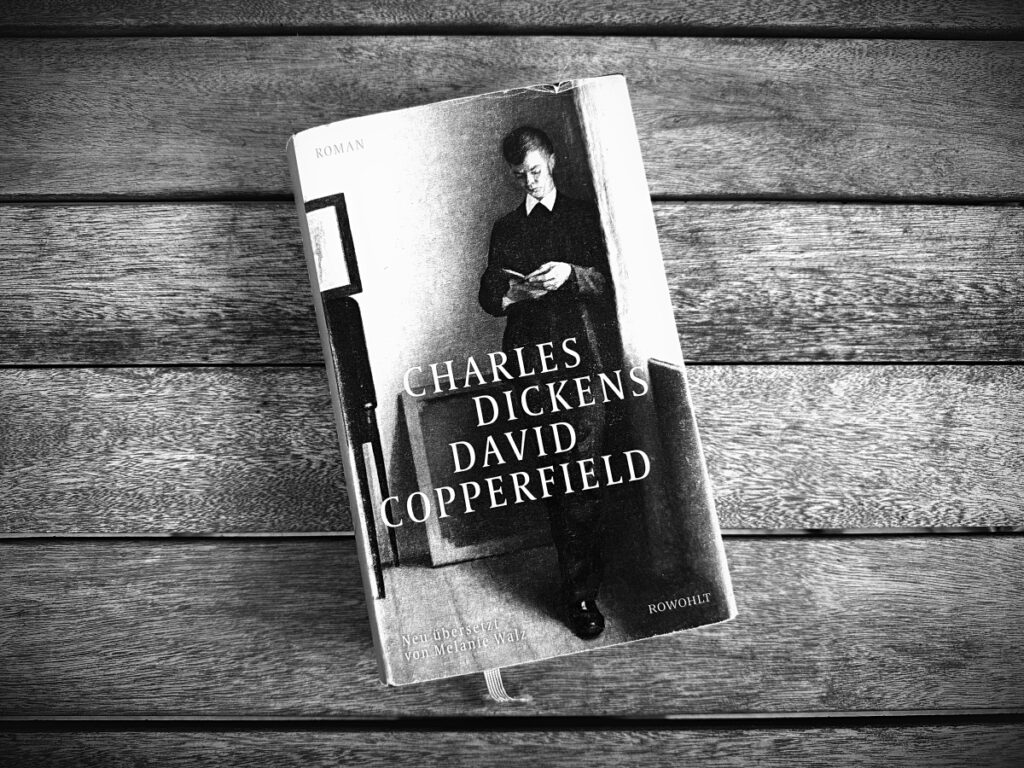
Schönes Lesen noch!